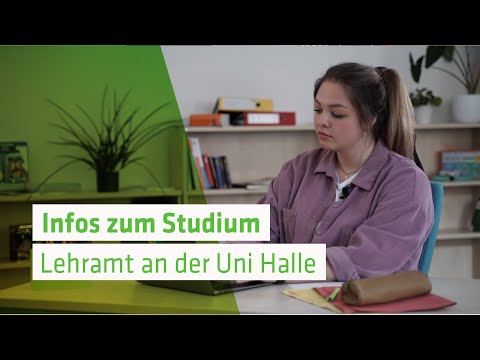Geistigbehindertenpädagogik / Verhaltensgestörtenpädagogik Lehramt an Förderschulen, modularisiert
Allgemeine Informationen
| Abschluss | Erstes Staatsexamen Lehramt an Förderschulen |
|---|---|
| Umfang | 30/30 LP |
| Regelstudienzeit | 9 Semester |
| Studienbeginn | nur Wintersemester |
| Studienform | Direktstudium, Vollzeitstudium |
| Hauptunterrichtssprache | Deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | zulassungsfrei (ohne NC) |
| Studieren ohne Hochschulreife | ja (Details) |
| Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen | nein |
| Fakultät |
Zentrum für Lehrer*innenbildung |
Studieninhalt
Die Angaben auf dieser Seite beziehen sich nur auf die gewählte förderpädagogische Fachrichtungskombination – die insgesamt nur ein Viertel des Studiums für das Lehramt an Förderschulen ausmacht. Informieren Sie sich daher zusätzlich über die allgemeinen und weiteren „Bausteine“. Nur zusammen ergibt sich ein Gesamtbild über Ihr Studium und den Weg ins Berufsleben als Förderschullehrer*in.
Fachrichtung Geistigbehindertenpädagogik
Ein zentraler Schwerpunkt, der über die Grenzen der Lehre hinaus auch entscheidend in die Forschungsaktivitäten des Lehrbereiches am Institut für Rehabilitationspädagogik hineinreicht, ist das Thema Autismus, insbesondere in seiner pädagogischen Relevanz.
Andere Schwerpunkte im Studium sind:
- Geistige Behinderung und/oder Autismus in Verbindung mit Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Störungen sowie diesbezügliche Handlungsmöglichkeiten und Konzepte pädagogischer und therapeutischer Arbeit (z. B. positive Verhaltensunterstützung)
- Geistige Behinderung und wiederkehrende (lebensgeschichtliche) Krisen und Konflikte
- Geistige Behinderung im Alter sowie der Umgang mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen (z. B. Demenz)
- Formen des Wohnens (z. B. betreute Wohnformen, Einzelwohnen).
- Arbeit und Konzepte beruflicher Rehabilitation oder beruflicher Integration (Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung, unterstützte Beschäftigung o. ä.) sowie statuspassagenförmige Übergänge
- Kunst und kreative Ausdrucksformen von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder von Menschen im Autismus-Spektrum.
| Modulübersicht Geistigbehindertenpädagogik (gesamt: 30 Leistungspunkte) |
LP | empf. Sem. |
|---|---|---|
| Einführung in Pädagogik und Soziale Arbeit bei Menschen mit geistiger Behinderung | 10 | 1.u.2. |
| Didaktische Konzeptionen und Lernbereiche für den Unterricht bei Schülern mit geistiger Behinderung | 5 | 3. |
| Pädagogische Handlungsmöglichkeiten bei Schülern mit speziellem Unterstützungsbedarf | 5 | 4. |
| Reflexion von Schulpraxis – Schulpraktische Übungen (SPÜ) Geistigbehindertenpädagogik | 5 | 5. |
| Spezielle Arbeitsschwerpunkte in der Geistigbehindertenpädagogik | 5 | 5.u.6. |
- Geistigbehindertenpädagogik: Modulübersicht als PDF
- Geistigbehindertenpädagogik: Modulhandbuch mit detaillierten Beschreibungen
--
Fachrichtung Verhaltensgestörtenpädagogik
Studierende dieser Fachrichtung beschäftigen sich u. a. mit folgenden Themen:
- Einblicke in theologische, moralische, medizinische, psychologische und soziologische Erklärungsansätze von Gefühls- und Verhaltensstörungen bei Kindern
- Überblick über die theoretische Fundierung und praktische Umsetzung von Präventions- und Interventionsmöglichkeiten im Arbeitsfeld der Verhaltensgestörtenpädagogik
- Einblick in die institutionellen Strukturen und rechtlichen Grundlagen in diesem Arbeitsfeld
- Zusammenfassung des entwicklungspsychologischen Kenntnisstandes zur Entstehung von Gefühls- und Verhaltensstörungen (z.B. Deprivation, Bindungstheorie, Resilienz)
- Diagnose und Klassifikation von Gefühls- und Verhaltensstörungen (internationale Klassifikationssysteme psychischer Störungen)
- Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse der Schul- und Unterrichtsforschung in ihrer Bedeutung für die schulische Erziehungshilfe
- Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen in schulischen Handlungsfeldern (schulische Integration)
- Überblick über das Zusammenwirken von Pädagogik und therapeutischen Angeboten
- Erarbeitung von Beispielen pädagogisch-therapeutischen Arbeitens
- Analyse von Krisensituationen und möglichen Interventionsformen
- Überblick über die außerschulischen Handlungsfelder in der Verhaltensgestörtenpädagogik
- Empirische Analyse von Fällen einschließlich theoretischer Reflexion
- Systematik, Aufbau und Erarbeitung von Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensproblemen
- Professionelle Reflexion und videogestützte Selbstbeobachtung in Praxissituationen
- Einblick in schwierige Lebenslagen für kindliche Entwicklung
- Überblick über die wichtigsten didaktischen und pädagogischen Arbeitsansätze in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
|
Modulübersicht Verhaltensgestörtenpädagogik (gesamt: 30 Leistungspunkte) |
LP | empf. Sem. |
|---|---|---|
| Einführung in die Pädagogik bei Gefühls- und Verhaltensstörungen | 10 | 1.u.2. |
| Spezielle Fragestellungen der Verhaltensgestörtenpädagogik | 5 | 3. |
| Reflexion von Schulpraxis – Schulpraktische Übungen (SPÜ) Verhaltensgestörtenpädagogik | 5 | 4. |
| Pädagogische Handlungsfelder in der Verhaltensgestörtenpädagogik | 5 | 5. |
| Pädagogisch-therapeutische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen | 5 | 7. |
Zulassungsvoraussetzungen
Genaue Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen finden Sie unter Lehramt an Förderschulen.
Bewerbung/Einschreibung
Genaue Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter Lehramt an Förderschulen.
Inhaltlich verwandte Studiengänge
-
Geistigbehindertenpädagogik / Körperbehindertenpädagogik
Kombi Erstes Staatsexamen Lehramt an Förderschulen, 30/30 LP, zulassungsfrei (ohne NC) -
Lernbehindertenpädagogik / Sprachbehindertenpädagogik
Kombi Erstes Staatsexamen Lehramt an Förderschulen, 30/30 LP, zulassungsfrei (ohne NC) -
Lernbehindertenpädagogik / Verhaltensgestörtenpädagogik
Kombi Erstes Staatsexamen Lehramt an Förderschulen, 30/30 LP, zulassungsfrei (ohne NC) -
Sprachbehindertenpädagogik / Körperbehindertenpädagogik
Kombi Erstes Staatsexamen Lehramt an Förderschulen, 30/30 LP, zulassungsfrei (ohne NC)
Fachstudienberatung
Bitte wenden Sie sich mit Detailfragen zu Studieninhalt und -ablauf direkt an die Fachstudienberatung.
Dr. Wolfram Kulig
Institut für Rehabilitationspädagogik
Franckeplatz 1
Raum: 144
06110
Halle (Saale)
Telefon: +49 345 55-23759 E-Mail: wolfram.kulig@paedagogik.uni-halle.de